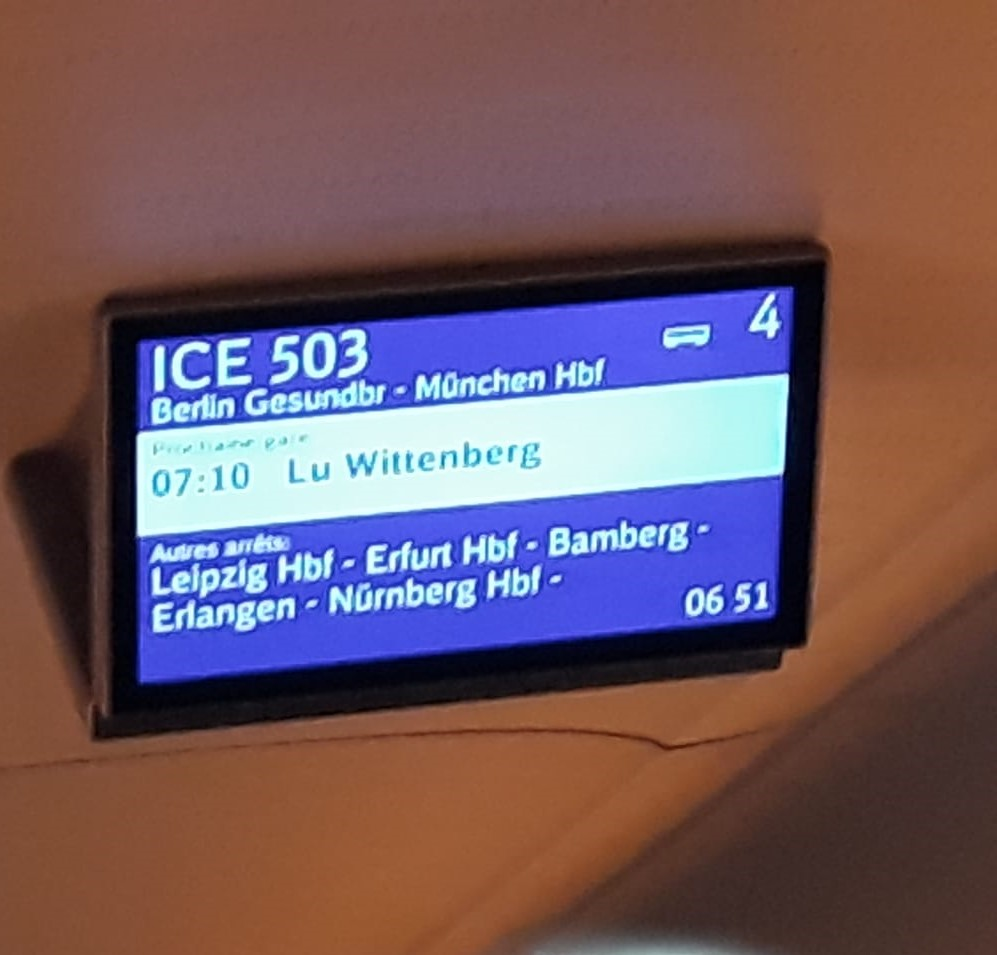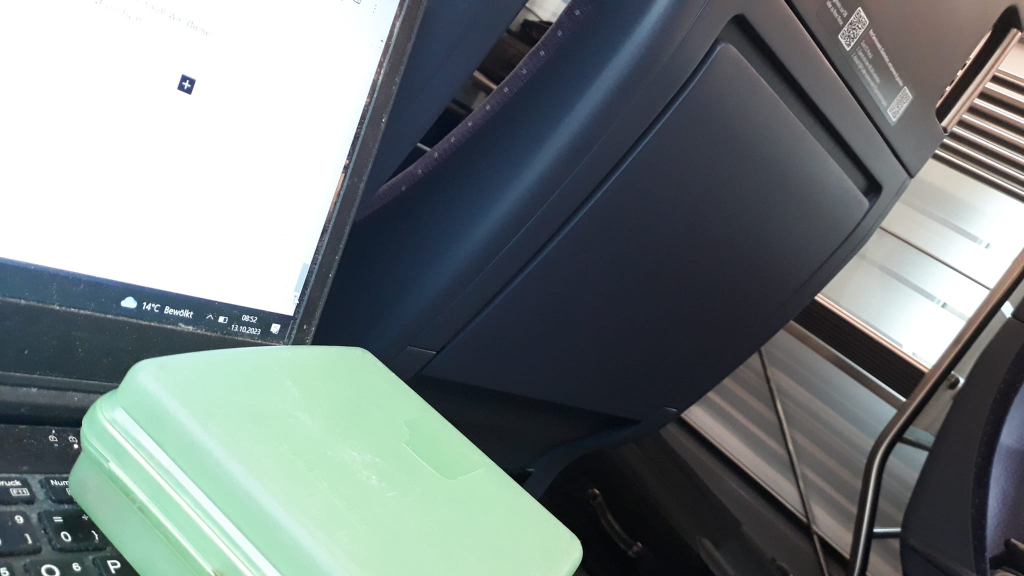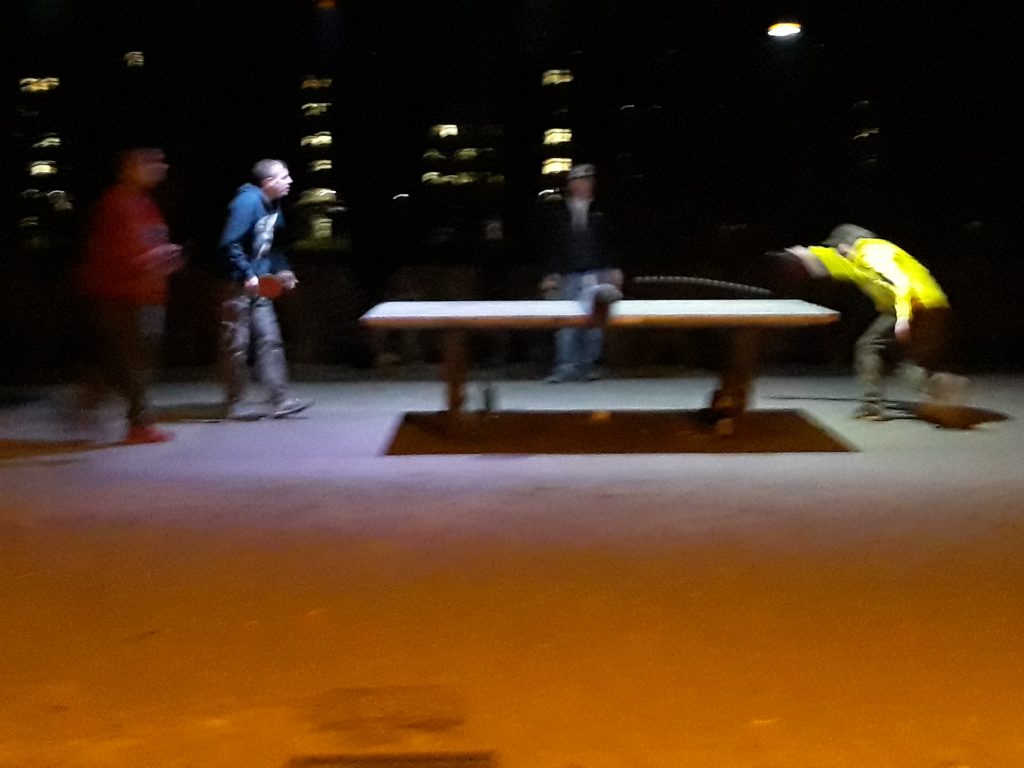The Marth mit ihrer Hedi und Sippe beim Alba Spiel, ich über die Oberbaumbrücke zu Salut am Schlesi. Die Wunde ist der Ort der Heilung, also auf nach X-Berg, wenn schon mein Zen-Balkon im November nicht mehr wirklich der Platz zum Schreiben ist und ‚draußen‘ trotzdem eine feine Sache.

‚Salut‘ gehört inzwischen, wie meine Küche(n) oder die rote rieder‘sche Picknickdecke zu den ‚Lebensorten‘, die mich über die Jahre in den unterschiedlichsten Konstellationen, Zusammenhängen und Phasen begleitet haben. In diesem Falle ist das Besondere, dass der Ort lange vor meiner Berlin Zeit auftauchte und sich in diese hinein und über die Jahre durch sie hindurch zu einer Konstanten entwickelt hat, die in meinem Leben bis dahin kaum Entsprechungen findet.

Genau genommen gibt es nur eine, die sich ebenso gegensätzlich verhält was die Beschaffenheit des Ortes betrifft, wie sich die Wirkung gleicht, die beide Orte auf mich ausüben.

Der Friedhof außerhalb der kleinen Gemeinde Breitsesterhof im nordpfälzer Bergland ist so gelegen, das man über eine Senke hinweg in der die Landstraße zwischen Thallichtenberg und Baumholder verläuft auf einen Aussiedlerhof schaut. Dort war das Grab‘ meiner Großeltern. Auf dem Grabstein stand wie selbstverständlich mein Name, da mein Vater, mein Großvater und etliche meiner Vorväter diesen Namen trugen. Wenn ich es recht erinnere hat mein Lehreronkel das mal bis in die 18hunderter Jahre zurück verfolgt als die Familie wegen irgendeiner Pest aus Österreich weg musste und ihnen von irgendwem Land im Ostpreussischen zugewiesen wurde. Gumbinnen im Kreis Goldap, der Geburtsort meines Vaters.

Mit meinem Onkel hat er diesen Hof gebaut, damals Maurerlehrling in Baumholder, wo der Familie nach ‚der Flucht‘ wiederum Land zugewiesen wurde, dass dieser älteste Bruder meines Vaters dann bewirtschaftete. Die ‚Alten‘ dort begraben waren als Kind mein weitester Link in die Vergangenheit und auf dem Grabstein stand neben der Lina, von der Martha ihren zweiten Namen hat, auch der Großvater – Johannes den ich, wie den Vater meiner Mutter nie kennen gelernt habe.
Oberhalb des Grabes gab es einen Absatz, den eine Steintreppe empor führte und oben zwischen Birken ein paar Kriegsgräber der gefallenen des Ortes im 2. Weltkrieg. Daneben eine Bank.

Mein Job bei den Besuchen dort war das Wasser, welches vom genau auf der entgegen gelegenen Seite des Friedhofs aus einem Brunnen geholt werden musste. Es war eine große Freude etliche Gießkannen, die dort an einer Metallstange aufgehängt waren, mit Wasser zu füllen und den ganzen Weg quer zu schleppen, wobei ich mir nie klar geworden bin, welches denn nun der effizienteste Weg ist.

Während meine Mutter und meine Oma damit beschäftigt waren das Grab herzurichten, meist weil sich irgendein Besuch aus der Verwandtschaft meines Vaters angekündigt hatte, saß ich, wenn kein Wasser gebraucht wurde auf eben dieser Bank, schaute über die Senke auf den Hof, umgeben vom Andenken an die Weltkriegsgefallenen und ‚berührte‘ wohl jedes mal meine indirekte Vergangenheit, meine Herkunft. Dazu gehörte der eigene Name auf dem Grabstein genauso, wie die Tatsache, dass mein Vater nur wenn es absolut unumgänglich (Verwandtschaftsbesuch!) war da hin kam und die Übernahme der Grabpflege durch Mutter und Großmutter ein bekanntes Konfliktfeld zwischen meinen Eltern war.
Unabhängig davon fand ich in dem Ort auf der Bank zwischen den Birken und den Kriegsgräbern eine ganz eigene Ruhe, die ich später unter Anderem in der Sterbephase meiner Mutter immer wieder dort gesucht und gefunden habe.

Nun also Berlin…..Schlesi….Salut, ein halbes Jahrhundert später.
Komplett anders das Setting, diametral entgegengesetzter Ort.
1986 zum ersten Mal eine Minipizza für zwei Mark an der Ecke gegenüber vom U-Bahnhof genommen und über die Budgetschonung gefreut. Finsterer Ort, West Berlin-Ende. Über die Oberbaumbrücke? Pah. Eiserner Vorhang. Die Randlage hielt den Kiez rottig und X-Berg war damals für den gerade volljährigen Hinterpfalzwessi, der ich war, eh ein anderer Planet. Dazu eben diese harte Grenze, die ja dann insgesamt schon damals durch die Begegnung mit Bärbel eine nicht unwesentliche Rolle in meinem Leben spielte.

Salut erstmals in den 90’ern als X-Berg auf einmal ‚mittendrinn‘ und das Schlesische Tor nicht mehr Endstation war. Der trocken, nicht zu süße türkische Baäckereikram ging mir ebenso ein, wie der ewige Schwarztee, den ich prägend von der Türkeireise mir Henning Jahre zuvor mitgebracht hatte.
Dazu der Ort an dem das Leben immer und ungebrochen vorbeifließt, wie der Bäcker offen hat: 24/7, das ganze Jahr über. Hier ist für mich die Herzmitte Berlins, wo es in der Art schlägt und pulsiert, dass ich mich wiederfinden kann in all dem bunten, schrägen, abseitigen, traurigen, lebensfrohen und niemals abgehobenen Leben welches sich vom Kanal her erstreckt. Neukölln damals noch kein Thema und das inzwischen auch deutlich gentrifizierte Treptow auf der anderen Seite des Kanals, wo wir in den letzten Jahren den unverbauten Blick von der Dachterrasse auf das X-berger Silvesterfeuerwerk hatten, war noch schwer Ostgeprägt, der 194’er schon etabliert aber immer noch gefühlt ‚grenzüberschreitend‘.
Standardprogramm bei jedem Aufenthalt in den darauf folgenden Jahren, dann nach dem Umzug in die Stadt Zufluchtsort an Sonntagen, während ausgedehnter Charité Aufenthalte zwischen 2007 und 2009. ‚Im Leben sein‘, statt auf Station: das gab‘ es hier, Sonntag für Sonntag, mit schwarzem Tee und Nusshörnchen, stundenlang.

Zeitgleich beginnend der Club unterm U-Bahnhof wo über die Jahre ungezählte großartige Konzerte zu erleben waren. Unwiederbringliche Momente des Glücks, wenn sich Trixie Whitley für zwei Songs in ihren damals schon toten Vater wechselbalgt, das gesamte männliche Ü-50 Publikum die Thirdeyeblind Hits Wort für Wort mitsingt und der Sänger die hohen Parts, die er nicht mehr schafft einfach auslassen darf ohne, dass es auffallen würde in all der Seeligkeit. Nur getoppt vom schmerzzerfressenen Willis Earl Beal der, loneliest man alive‘ als der Bühnenstrom Kollabiert einfach solo, acapella das Konzert im Dunkeln zu Ende bringt und sich jegliche Würdigung wie auch Zugaben verbittet. Ewigkeitsmoment.
Vor wie vielen X-Berg-Events sich hier getroffen wurde hab‘ ich nicht gezählt aber an diversen entscheidenden Tagen hat auch dieser Ort seine Rolle gespielt, mir zugehört, mich verortet, mich beruhigt und mir Klarheit und Denkschärfe ermöglicht und das obwohl hier genau das Gegenteil von Ruhe und Einkehrumgebung gegeben ist.

Aus dem Fotoautomaten nebenan stammen entsprechend viele der schwarzweis Streifen, die seit jeher mein Berlinleben begleitet und entsprechende Momente eingefangen haben. Seit dem Abriss der diplomatischen Beziehungen nach Treptow führt es mich seltener automatisch hier vorbei. In den letzten Jahren lag ‚Salut‘ oft quasi auf dem Arbeitsweg und gab dann auch meist das Trockenteilchen zum Bürokaffee her. Heute bewege ich mich manchmal bewusst hierher um mir den Ort und seine stärkende Wirkung zu erhalten, manchmal ergibt es sich, wie heute wo s’Marth mit der Familie ihrer Freundin in der Dingsbumsarena zum Alba-Basketballspiel ist. Abholen unnötig. Das große Kind kennt den Ort und findet den Weg über die Brücke alleine. So braucht es kein Date. Wann immer das Spiel zu Ende ist braucht sie 20 Minuten. Bis dahin drei Stunden Zeit zum Sein, Sitzen, Schauen, Schreiben, Schwarztee trinken….

Dann gibt es ein X-Berg Abendbrot beim Pizzamann auf der Ecke und auf dem Heimweg holen wir bei Mamanke in der Danziger noch den Schulranzen für morgen früh.